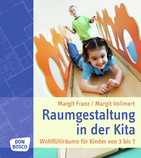Die Pädagogin Margit Franz und die Designerin Margit Vollmert beschäftigen sich in fünf Kapiteln mit grundsätzlichen Aspekten der Raumgestaltung: der Wahrnehmung von Räumen, Orten im Lebensraum Kindertagesstätte, Kriterien zur Raumgestaltung, Gestaltungsgrundsätzen sowie den Schritten zur Entwicklung eines Raumkonzepts. Das Buch enthält eine Fülle von Spezialwissen, insbesondere zum Thema Farbe und Farbwirkung, aber auch zu den Orten für Erwachsene. Die Hinweise zur Gestaltung der Arbeitsplätze von Erzieherinnen sind ausgesprochen differenziert. Es wird Bezug genommen auf die Ergonomie, also die Wissenschaft, die sich mit der menschengerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen befasst. Franz und Vollmert zitieren eine Studie, die umfangreiche Daten über die psychischen und physischen Belastungen von Erzieherinnen erhoben hat und zu dem Schluss kommt, dass vor allem die akustischen und die Lichtverhältnisse sowie die Ausstattung der Räume verbessert werden müssen.
Das Buch will Denkanstöße geben. Es setzt sich kritisch von einer vernied-lichenden, vorgeblich kindgemäßen Raumgestaltung ab. Die Autorinnen gehen davon aus, dass nicht nur die äußere, sondern gleichermaßen die innere Gestaltung von Kindergärten keine Privatsache und deshalb – so betonen sie – auch keine Geschmacksfrage sein kann. Raumgestaltung ist für sie sowohl eine ästhetische als auch eine konzeptionelle Herausforderung. Allerdings legen sich Franz und Vollmert nicht auf eine Konzeption fest, obwohl sie davon ausgehen, dass die Frage nach der Gestaltung zuerst die Frage nach der Funktion von Räumen beantworten muss. Sie halten es also offenbar für möglich, sich unabhängig von Konzepten über die Funktion von Räumen Gedanken machen zu können.
Statt auf Konzeptionen gehen sie auf verschiedene Kriterien ein, wie auf die Atmosphäre von Räumen, auf Ästhetik, Wertigkeit, Symmetrie, Asymmetrie und Gestaltgesetze. Bei dieser Gelegenheit scheuen sie sich nicht, sich auch über Kitsch zu äußern, den sie zwar nicht verbannen wollen, weil sie davon ausgehen, dass Kinder Kitsch lieben. Sie möchten ihn allerdings nur als bewegliches, zeitlich begrenztes Mitbringsel der Kinder und nicht als Teil der Institution Kindergarten akzeptieren.
Im Vergleich zu solchen klaren Stellungnahmen bleiben die Autorinnen bei der Beschreibung der Räume der Kinder vage. Sie sprechen vom „zweiten Wohnraum“ der Kinder, der zugleich Arbeitsplatz der ErzieherInnen und Besuchsort der Eltern ist. Bei den Anforderungen an die Räume stellen sie fest: „ Ein einziger (Gruppen-) Raum kann nicht alle Grundbedürfnisse gleichermaßen befriedigen“(S. 23). Sie plädieren für eine gruppenüber-greifende Arbeit, in der die einzelnen Gruppen „Profil“ zeigen und großzügige, gut ausgestattete, attraktive Spielbereiche einrichten.
Insgesamt erscheint mir das Buch als eine gute Grundlage für eine interdiszip-linäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Experten wie Pädagogen, Architekten, Lichtplanern und Handwerkern. Auch für die Fortbildung der Fortbildner und Fachberatungen halte ich es für geeignet. Allerdings nicht, um den Anspruch einzulösen, die Räume mit Kindern zusammen zu verändern. Das geht schon allein deswegen nicht, weil sich Franz und Vollmert nur in einem der Kapitel unter dem Stichwort „Orte für Kinder“ mit den Bedürfnissen von Kindern beschäftigen. Es scheint mir einfach nicht das Thema des Buches zu sein. Stattdessen setzen sie sich in einem sehr lesenswerten Kapitel zum Beispiel ausführlich mit Farbsymbolik und Assoziationen, der Wirkung von Farben im Raum, also an der Decke, an der Wand und auf dem Boden, auseinander sowie mit dem Einfluss von Farben auf die Proportionen des Raums. Mir fiel auf: Alles, was hier an exquisiten Überlegungen zu Farbe dargelegt wird, ruft nach offener Arbeit in Funktionsräumen. Denn nur, wenn man Räumen bestimmte Funktionen zuweist, lassen sich Farbwirkungen auch gezielt einsetzen. Hierauf wollen sich die Autorinnen allerdings nicht festlegen, so dass meine Schlussfolgerung vermutlich nicht ihren Intentionen entspricht: Ich finde, dass das Buch gerade unter dem Gesichtspunkt der Anregungen zu einer ästhetischen, im Sinne einer wahrnehmungsanregenden Raumgestaltung für die offene Arbeit in Funktions-räumen sehr hilfreich ist.
Angelika von der Beek, Diplom-Pädagogin, Köln, erschienen in "TPS" Ausgabe 03-2006