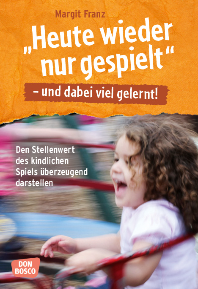Das vorliegende Buch widmet sich liebevoll dem Stellenwert des selbstbestimmten Spiels und ist ein einziges Plädoyer für das Recht des Kindes spielen zu dürfen. Es ist müßig darüber nachzusinnen, wer die Bedeutung des kindlichen Spiels am meisten heruntergespielt hat: Ehrgeizige oder ängstliche Eltern, die sich darum sorgen, dass der „Ernst des Lebens“ zu spät in die Kinderköpfe einziehen könnte oder so mancher Artikel aus der Frühpädagogik, in dem freies Spiel und Zeitverschwendung irgendwie zusammengedacht schienen? Sicher ist auch manch eine Kita dafür verantwortlich, weil sie das „Freispiel“ als Zwischenspiel zwischen Morgenkreis und Projektgruppe vernachlässigte. Und nicht zu vergessen auch der Förder- und Bildungshype, der die Spielräume von Kindern mit Lernspielzeug und Programmen vollpfropfte und dabei kostbare Spielzeit in der Kita begrenzte oder in „strukturierte Lernzeit“ verwandeln half. Wer nun schon lange seinen Fröbel im Regal verstauben ließ, findet seinen Geist und seine Wahrheit in dem neuen Buch von Margit Franz. Systematisch trägt sie alles Wissenswerte zusammen, was das Spiel auszeichnet: Die Freiheit von äußeren Zwängen und Zwecken, das Freisein von nicht selbst definierten Lernzielen, nicht angewiesen auf einen vermittelnden Einfluss der Erwachsenen, angetrieben von der Neugier, mit denen Kinder noch immer auf die Welt kommen. Im selbstorganisierten Spiel erobern sie sich neue Handlungsfelder, gehen mit Begeisterung an ihre Grenzen, geben nicht auf, setzen sich selbst immer neue Ziele. Im Spiel lernen sie neue Verhaltensweisen, um sich in einer komplexen, sich ständig verändernden Welt zurechtzufinden. Die Autorin zeigt auf allen Ebenen, wie Kinder spielend lernen, wie sich dabei soziale, kreative und kognitive Intelligenz ausbildet: „Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern ein absolutes Traumpaar.“ (S. 52)
Margit Franz fragt nach, ob das Freispiel nicht einen anderen Namen braucht. Und wenn es schon so heißt, wie sieht wirkliches, freies Spiel aus? Damit ihr Wissensdurst und ihre Entdeckungslust erhalten bleiben und immer wieder neue Nahrung findet, brauchen Kinder Spielräume, in denen sie eigenverantwortlich handeln, die sie gestalten können, in denen sie nicht dauernd bei den Erwachsenen nachfragen müssen: „Darf ich das spielen?“, „Darf ich Wasserfarben haben?“, „Darf ich in die Bauecke?“, „Darf ich allein draußen spielen?“
Eine umfangreiche Sammlung von Tipps macht deutlich, wie gut die Autorin die Arbeit in der Kita kennt und wie sehr sie Erkenntnisse der Erziehungswissenschaft und gut gelebter Praxis in ihren Büchern vereinen kann. Jede Menge Anregungen, die das Spiel als wichtigste Form des Lernens in der Frühpädagogik wieder ins Zentrum rücken, diese Ur-Situation, die Freiheit, Zeit und Räume braucht, um sich entfalten zu können. Wie verankert man das Spielen in der Konzeption so, dass auch Eltern verstehen, warum es für die Kinder so wichtig ist? Ein Teil des Buches betrifft die Zusammenarbeit mit Eltern und wie man sie für selbstbestimmtes Spiel begeistern kann, mit Ideen für den Elternabend und Gesprächen zum Thema.
Neben vielen Praxistipps und Denk-Impulsen lassen sich auch viele gelungene Beispiele downloaden. Dieses Buch lässt Ihnen das Herz aufgehen. Versprochen.
Inge Pape, Diplom-Sozialpädagogin, Chefredakteurin in Ruhe der Fachzeitschrift TPS, veröffentlicht in TPS, Stuttgart, Ausgabe 05-2016